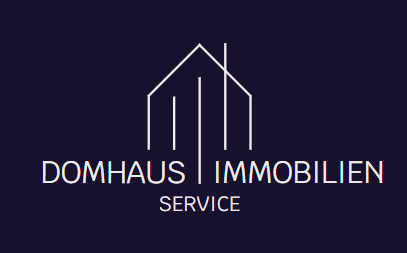Inklusion durch Technik: Das Ziel des BFSG
Das BFSG ist ein deutsches Gesetz, das Unternehmen verpflichtet, bestimmte digitale Produkte und Dienstleistungen barrierefrei zu gestalten, um Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu digitalen Angeboten zu ermöglichen.">Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) verfolgt ein zentrales gesellschaftliches Ziel: eine inklusive Teilhabe am wirtschaftlichen und digitalen Leben für alle Menschen – unabhängig von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen.
In Deutschland leben laut amtlicher Statistik mehr als zehn Millionen Menschen mit Behinderungen, davon etwa sieben Millionen mit anerkannten Schwerbehinderungen. Diese Zahl steigt seit Jahren kontinuierlich – auch aufgrund der alternden Bevölkerung. Gleichzeitig wird der Alltag immer digitaler: Einkaufen, Reisen, Bankgeschäfte, Kommunikation oder Behördengänge finden heute überwiegend online statt. Genau hier setzt das BFSG an.
Digitale Barrieren sind gesellschaftliche Barrieren
Viele digitale Produkte und Dienstleistungen sind heute noch nicht barrierefrei nutzbar: Websites ohne Tastaturnavigation, Apps ohne Screenreader-Kompatibilität, Fahrkartenautomaten mit schwer lesbaren Displays oder E-Book-Reader ohne Vorlesefunktion schließen ganze Bevölkerungsgruppen aus.
Das BFSG will diese technischen Barrieren abbauen, damit alle Menschen unabhängig von Einschränkungen gleichberechtigt am gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Leben teilhaben können. Ziel ist ein universelles Design: Produkte und Services sollen von möglichst vielen Menschen ohne zusätzliche Anpassungen oder Hilfsmittel genutzt werden können.
Technik als Brücke – nicht als Hürde
Das Gesetz versteht Technologie als Werkzeug für Inklusion. Barrierefreiheit wird damit nicht länger als Sonderlösung für einzelne Nutzergruppen betrachtet, sondern als Qualitätsmerkmal für alle.
Beispiele für inklusive Technik, die durch das BFSG gefördert wird:
Geräte mit Sprachsteuerung für Menschen mit eingeschränkter Motorik
Für viele Menschen mit motorischen Einschränkungen – etwa infolge von Lähmungen, Muskelerkrankungen, Multiple Sklerose, Rheuma oder auch nach Unfällen – stellt die Bedienung klassischer Eingabegeräte wie Tastaturen, Touchscreens oder Mäuse eine enorme Hürde dar. Oft sind präzise Bewegungen oder eine längere Halte- und Klickfähigkeit schlicht nicht möglich. Genau hier entfaltet Sprachsteuerung ihr inklusives Potenzial.
Sprachgesteuerte Geräte ermöglichen eine vollständig berührungsfreie Interaktion mit Technik: Nutzerinnen und Nutzer können über gesprochene Befehle Geräte einschalten, Programme öffnen, Texte diktieren, Einkäufe tätigen oder Suchanfragen im Internet ausführen. Moderne Systeme erkennen auch natürliche Sprache, sodass keine komplizierten Befehlsstrukturen erlernt werden müssen.
Beispiele, wie Sprachsteuerung Barrieren abbaut:
-
Computer und Smartphones: Betriebssysteme bieten integrierte Spracherkennung, mit der sich sämtliche Funktionen steuern lassen – von der Texteingabe über das Navigieren in Menüs bis hin zum Versenden von Nachrichten.
-
Smart-Home-Geräte: Licht, Heizung, Rollläden oder Haushaltsgeräte können per Sprachbefehl bedient werden, was insbesondere für Personen im Rollstuhl oder Bett eine enorme Selbstständigkeit ermöglicht.
-
Assistive Eingabegeräte: Sprachsteuerung wird zunehmend mit Augensteuerung oder Kopfbewegungssensoren kombiniert, um Nutzerinnen und Nutzern mit sehr geringer Muskelkontrolle alternative Eingabemethoden zu bieten.
Neben der praktischen Funktion bringt Sprachsteuerung auch einen emotionalen Mehrwert: Sie reduziert die Abhängigkeit von Hilfspersonen und stärkt das Gefühl der Selbstbestimmung.
Das BFSG fördert solche Technologien, indem es vorschreibt, dass digitale Produkte so gestaltet werden müssen, dass sie von Menschen mit motorischen Einschränkungen ohne zusätzliche physische Bedienhilfen genutzt werden können. Sprachsteuerung ist damit ein zentraler Schlüssel, um digitale Teilhabe für alle zu ermöglichen.
Kontrastreiche Benutzeroberflächen für sehbehinderte Nutzer
Menschen mit Sehbehinderungen – dazu gehören Personen mit eingeschränktem Sehvermögen, Farbsinnstörungen, Grauem Star, Makuladegeneration oder diabetischer Retinopathie – stoßen im digitalen Alltag häufig auf dieselbe Barriere: Inhalte sind zwar vorhanden, aber visuell kaum wahrnehmbar.
Viele Websites, Apps oder Geräteoberflächen nutzen blasse Farben, filigrane Schriftarten und geringe Kontraste. Für sehbehinderte Nutzer bedeutet das, dass Texte verschwimmen, Bedienelemente unklar wirken und wichtige Informationen schlicht nicht erkannt werden. Das BFSG setzt genau hier an und verlangt, dass digitale Produkte so gestaltet sein müssen, dass sie auch bei eingeschränktem Sehvermögen nutzbar bleiben.
Kontrastreiche Benutzeroberflächen sind dabei einer der wirkungsvollsten und zugleich technisch einfach umsetzbaren Ansätze. Sie sorgen dafür, dass sich Text deutlich vom Hintergrund abhebt und Bedienelemente klar erkennbar sind. Dabei gilt: Je höher der Kontrast, desto besser sind Inhalte auch bei schwachem Sehen oder ungünstigen Lichtverhältnissen lesbar.
Typische Maßnahmen für barrierearme visuelle Gestaltung:
-
Hohe Farbkontraste: Texte, Icons und Schaltflächen sollten mindestens ein Kontrastverhältnis von 4,5:1 zum Hintergrund aufweisen (empfohlener WCAG-Standard), besser noch 7:1 für Fließtexte.
-
Verzicht auf rein farbliche Unterscheidung: Informationen sollten nicht nur über Farben vermittelt werden, sondern auch durch Symbole, Umrandungen oder Muster. So können auch Menschen mit Farbenfehlsichtigkeit Inhalte unterscheiden.
-
Flexible Schriftgrößen und Zoom-Funktionen: Nutzer müssen Texte ohne Qualitätsverlust vergrößern können – idealerweise bis auf 200 % der Originalgröße.
-
Klares visuelles Layout: Genügend Abstand zwischen Elementen, gut erkennbare Fokusrahmen und konsistente Navigationsstrukturen verhindern visuelle Überforderung.
Kontrastreiche Designs sind dabei kein ästhetischer Nachteil – im Gegenteil: Studien zeigen, dass alle Nutzergruppen von klar lesbaren, strukturierten und kontrastreichen Oberflächen profitieren, da sie die Lesegeschwindigkeit und Fehlertoleranz verbessern.
Für Menschen mit Sehbehinderungen bedeuten sie jedoch mehr als nur Komfort: Sie machen den Unterschied zwischen digitaler Ausgrenzung und echter Teilhabe. Genau deshalb stuft das BFSG sie als verpflichtenden Bestandteil barrierefreier Gestaltung ein.
Vorlesefunktionen und Untertitel für Menschen mit Hör- oder Sehbehinderungen
Digitale Informationen sind heute allgegenwärtig – doch nicht jeder Mensch kann sie in der angebotenen Form wahrnehmen. Für Menschen mit Sehbehinderungen stellt geschriebener Text eine Barriere dar, während Hörbehinderte oder Gehörlose auditive Inhalte wie Videos, Podcasts oder Systemtöne nicht erfassen können. Ohne passende Alternativen sind viele Inhalte damit faktisch unzugänglich.
Genau hier setzen Vorlesefunktionen und Untertitel an, die im Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) als zentrale Anforderungen an barrierefreie Produkte und Dienstleistungen festgeschrieben werden. Sie ermöglichen es, denselben Inhalt in einer anderen Sinnesmodalität wahrzunehmen – und schaffen damit echte Inklusion.
Vorlesefunktionen: Schriftinhalte hörbar machen
Vorlesefunktionen (Screenreader oder Text-to-Speech-Systeme) wandeln digitale Texte automatisch in gesprochene Sprache um. Für Menschen mit Blindheit oder starker Sehschwäche sind sie oft der einzige Zugang zu digitalen Inhalten.
Moderne Screenreader können nicht nur Fließtexte vorlesen, sondern auch:
-
Navigationsstrukturen interpretieren (Menüs, Überschriften, Schaltflächen)
-
Formularelemente beschreiben (z. B. „Eingabefeld für E-Mail-Adresse“)
-
Alternative Texte für Bilder ausgeben, um auch visuelle Inhalte zugänglich zu machen
-
Dateien, E-Books, Webseiten oder PDF-Dokumente vollständig auditiv zugänglich machen
Damit solche Systeme funktionieren, müssen Inhalte technisch korrekt strukturiert und semantisch ausgezeichnet sein – z. B. mit HTML-Überschriften, ARIA-Labels oder Alternativtexten für Bilder. Das BFSG verpflichtet Unternehmen dazu, ihre Produkte so zu entwickeln, dass sie mit gängigen Vorlesetechnologien kompatibel sind.
Untertitel: Auditive Inhalte visuell erfassbar machen
Für Menschen mit Hörbehinderungen sind Untertitel der entscheidende Zugang zu auditiven Informationen. Sie machen nicht nur gesprochene Sprache sichtbar, sondern können auch relevante Hintergrundgeräusche oder Tonstimmungen beschreiben (z. B. „[Applaus]“ oder „[leise Musik]“).
Untertitel sind besonders wichtig bei:
-
Videos, Schulungsfilmen und Werbung
-
Produktpräsentationen, Video-Tutorials oder Webinaren
-
Sprachassistenten und interaktiven Assistenzsystemen, wenn diese Informationen nur akustisch ausgeben
Für eine echte Barrierefreiheit müssen Untertitel synchron, gut lesbar und dauerhaft verfügbar sein. Auch hier ist nicht nur der technische Aspekt wichtig, sondern auch der sprachliche Stil: Untertitel müssen klar, einfach und möglichst ohne Fachjargon formuliert sein.
Mehrwert für alle Nutzergruppen
Vorlesefunktionen und Untertitel sind nicht nur Hilfsmittel für einzelne Gruppen, sondern nützen einer breiten Masse von Menschen:
-
Nutzer mit Lern- oder Leseschwierigkeiten profitieren von vorgelesenen Texten
-
Menschen in lauter Umgebung können Inhalte dank Untertiteln trotzdem verstehen
-
Multilinguale Nutzer können Inhalte leichter erfassen, wenn sie hören und lesen kombinieren
-
Mobile Nutzer können Inhalte unterwegs konsumieren, ohne Ton aktivieren zu müssen
Das BFSG behandelt diese Funktionen deshalb nicht als „Sonderausstattung“, sondern als verpflichtenden Bestandteil barrierefreier digitaler Produkte und Dienstleistungen.
Fazit: Inhalte für alle Sinne zugänglich machen
Vorlesefunktionen und Untertitel verwandeln Informationen aus exklusiven Datensilos in universell zugängliche Inhalte. Sie sind ein zentraler Baustein digitaler Inklusion und machen den Unterschied zwischen Ausschluss und Teilhabe.
Das BFSG sorgt dafür, dass diese Funktionen künftig standardmäßig integriert werden müssen – und nicht erst nachträglich oder optional hinzugefügt werden. Unternehmen, die dies frühzeitig umsetzen, schaffen nicht nur Rechtssicherheit, sondern signalisieren Verantwortung und Wertschätzung gegenüber allen Nutzergruppen.
Einfache Sprache und klare Navigationsstrukturen für Nutzer mit kognitiven Einschränkungen
Menschen mit kognitiven Einschränkungen – beispielsweise durch Lernschwierigkeiten, Demenz, Autismus-Spektrum-Störungen oder Aufmerksamkeitsdefizite – stoßen im digitalen Alltag oft auf Barrieren, die nicht sichtbar, aber hochgradig einschränkend sind. Inhalte können zu komplex, verschachtelt oder überladen sein, was zu Verwirrung, Frustration oder völliger Nutzungsverweigerung führen kann.
Hier setzt das BFSG an: Digitale Produkte und Dienste müssen so gestaltet werden, dass sie von Menschen mit kognitiven Einschränkungen verständlich und intuitiv genutzt werden können.
Einfache Sprache: Verständlichkeit als Kernprinzip
Einfache Sprache ist mehr als nur kurze Sätze zu schreiben. Sie beinhaltet:
-
Klare Wortwahl: Vermeidung von Fachjargon, Abkürzungen und unnötig komplizierten Begriffen
-
Kurze, prägnante Sätze: Jede Aussage sollte leicht erfassbar sein und nur eine Information pro Satz vermitteln
-
Strukturierte Texte: Wichtige Informationen sollten hervorgehoben, Absätze übersichtlich gestaltet und Listen verwendet werden
-
Visuelle Hilfen: Icons, Bilder oder Infografiken unterstützen das Textverständnis
Ziel ist, dass Menschen ohne große Vorkenntnisse oder mit eingeschränkter Konzentration Inhalte eigenständig verstehen und nutzen können.
Klare Navigationsstrukturen: Orientierung leicht gemacht
Neben verständlicher Sprache ist eine intuitive Navigation entscheidend. Nutzer mit kognitiven Einschränkungen benötigen visuelle und logische Orientierungshilfen, um sich auf Webseiten, Apps oder digitalen Systemen zurechtzufinden. Dazu gehören:
-
Einheitliche Menüs und Buttons: Konsistente Positionierung erleichtert das Wiedererkennen von Funktionen
-
Eindeutige Beschriftungen: Schaltflächen und Links müssen klar benennen, was beim Klick passiert
-
Reduzierte Ablenkung: Überladene Oberflächen vermeiden, um die Aufmerksamkeit auf wesentliche Inhalte zu lenken
-
Schritt-für-Schritt-Anleitungen: Komplexe Prozesse wie Bestellungen, Registrierungen oder Formulare werden in klar gegliederte Schritte zerlegt
Diese Maßnahmen minimieren Fehler, erhöhen die Selbstständigkeit der Nutzer und verringern die Abhängigkeit von Hilfspersonen.
Mehrwert für alle Nutzergruppen
Einfache Sprache und klare Navigation nützen nicht nur Menschen mit kognitiven Einschränkungen:
-
Gelegenheitsnutzer oder ältere Menschen verstehen komplexe Inhalte leichter
-
Internationale Nutzer mit begrenzten Deutschkenntnissen profitieren von klarer Sprache
-
Mobile Nutzer können Inhalte schneller erfassen, da kurze Texte und intuitive Menüs die Bedienung vereinfachen
Damit wird deutlich: Barrierefreie Gestaltung ist kein Luxus, sondern ein Designprinzip, das die Nutzung für alle erleichtert.
Fazit: Digitale Teilhabe durch Verständlichkeit
Einfache Sprache und klare Navigationsstrukturen sind zentrale Bausteine, um digitale Inhalte für Menschen mit kognitiven Einschränkungen zugänglich zu machen. Sie stärken die Selbstständigkeit, das Verständnis und die Teilhabe am digitalen Leben.
Das BFSG verpflichtet Unternehmen dazu, solche Maßnahmen zu implementieren. Wer dies frühzeitig tut, erfüllt nicht nur die gesetzlichen Anforderungen, sondern schafft ein nutzerfreundliches und inklusives digitales Angebot für alle.
Solche Funktionen nützen nicht nur Menschen mit Behinderungen – auch ältere Personen, Gelegenheitsnutzer oder Menschen mit geringer Technikaffinität profitieren davon.
Inklusion als Wirtschaftsfaktor
Inklusion ist nicht nur ein soziales Ziel, sondern auch ein wirtschaftlicher Faktor:
-
Die Kaufkraft der Menschen mit Behinderungen und ihrer Haushalte wird in Deutschland auf über 400 Milliarden Euro jährlich geschätzt.
-
Unternehmen, die barrierefreie Produkte und Dienstleistungen anbieten, können ihre potenzielle Zielgruppe um bis zu 15 % vergrößern.
Damit schafft das BFSG einen starken Anreiz für Innovation und Markterweiterung, anstatt Barrierefreiheit als reine Pflicht zu behandeln.
Fazit: Vom Sonderfall zur Selbstverständlichkeit
Das BFSG will erreichen, dass Barrierefreiheit nicht länger ein Sonderfall ist, sondern zu einem selbstverständlichen Bestandteil von Produktentwicklung, Service und Kommunikation wird. Es markiert einen Wendepunkt: Technik soll nicht länger ausschließen, sondern Menschen verbinden – unabhängig von ihren Fähigkeiten.